Bedeutende Jugendstilkünstler waren oft sehr vielseitig tätig als Maler, Plastiker, Möbeldesigner und Architekten. Bisher wenig beachtet wurde ihre Arbeit als Textildesigner. Die Ausstellung im Museum Villa Stuck beleuchtet nun erstmals auch diesen Aspekt des künstlerischen Schaffens bedeutender Protagonisten des Jugendstils wie Peter Behrens, Hans Christiansen, Walter Crane, Johann Vincenz Cissarz, Otto Eckmann, Gertrud Kleinhempel, Albin Müller, Adelbert Niemeyer, Joseph Maria Olbrich, Richard Riemerschmid sowie anderer Künstler des Jugendstils.
Anhand von mehr als einhundert bisher selten oder noch nie öffentlich gezeigter Objekte aus den Jahren von ca. 1896 bis 1914 bietet sich hier die einmalige Gelegenheit, Entwürfe aus bedeutenden Zentren der Textilindustrie um 1900 in Deutschland, England, den Niederlanden und Österreich in ihrer Verbindung aus Künstlerentwurf und industrieller Fertigung in einer großen Übersicht zu betrachten und damit die Auseinandersetzung und das Zusammenwirken von Kunst und Industrie um 1900 zu erfassen.
Das spezielle Augenmerk der vorliegenden Ausstellung gilt dabei der sogenannten „abgepassten Ware“, also Tischdecken und Servietten, die im Gegensatz zu „Meterware“ mit Mustern im Rapport für Möbelbezüge, Vorhänge und Kleider steht. Hier hat der Entwurf, der im Kontext kompletter Inneneinrichtungen oder als Einzelstück entstanden ist, einem vorgegebenen Maß zu folgen; seine Komposition ist einem Rechteck oder Quadrat einbeschrieben und unterliegt der Disposition von Binnenfeld und Bordüre mit Ecklösung. Mit diesem Themenschwerpunkt widmet sich die Ausstellung im Museum Villa Stuck einer grundsätzlich anderen Gattung im Textilbereich als die 1980 in Stuttgart gezeigte Schau „Art Nouveau Textildekor um 1900“, die sich schwerpunktmäßig mit gewebten und bedruckten Stoffen mit Mustern im Rapport befasste, und stellt somit eine absolute Novität dar.
Die Exponate stammen aus den Firmenarchiven in Bielefeld und Laichingen (A.W. Kisker GmbH & Co.KG und Hermann Pichler GmbH & Co.KG), aus internationalen Privatsammlungen sowie zahlreichen Museen: dem Rijksmuseum in Amsterdam, den Staatlichen Museen zu Berlin, Kunstbibliothek, den Kunstsammlungen Chemnitz, dem Hessischen Landesmuseum und dem Institut Mathildenhöhe in Darmstadt, dem Städtischen Museum in Flensburg, dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, dem Deutschen Textilmuseum in Krefeld, dem Bayerischen Nationalmuseum, der Neuen Sammlung, dem Stadtmuseum und der Architektursammlung der Technischen Universität in München, dem Württembergischen Landesmuseum in Stuttgart und dem MAK, Museum für angewandte Kunst/ Gegenwartskunst in Wien.
Mit dem Thema Textilkunst des Jugendstils befasste sich das Museum Villa Stuck bereits 2004 in der Ausstellung „Schönheit der Formen. Textilien des Münchner Jugendstils“. Einen weiteren Höhepunkt zum Thema Jugendstil wird die für Herbst 2010 geplante große Schau zum Thema „Jugendstil aus Münchner Privatbesitz“ darstellen.
Zur Ausstellung
Tafeltücher aus Leinendamast sind seit Jahrhunderten Bestandteil der Inventare adliger Häuser und des Hofes. Mit dem Wechsel vom Handwebstuhl zur Jacquardmaschine seit dem frühen 19. Jahrhundert reduzierte sich zunächst die Kostbarkeit und Exklusivität solcher Textilien. Tafeltücher erfreuten sich zwar nach wie vor großer Wertschätzung, aber zu der bis dahin überwiegend aristokratischen Käuferschicht trat jetzt in zunehmender Breite das Bürgertum. Seitdem die Tücher durch neuartige Textilmaschinen und in preiswerteren Materialien – Baumwolle und farbigen Garnen – hergestellt wurden, waren sie einem größeren Kundenkreis zugänglich. Die Entwerfer der Muster blieben im 19. Jahrhundert noch weitgehend anonym. Nur in seltenen Fällen kennt man ihre Namen. Das änderte sich im Jahrzehnt ab 1890 grundlegend. Seither liegt der Wert kaum mehr im Material, sondern primär im Künstlerentwurf des Musters. Die Textilien erhielten damit einen anderen gesellschaftlichen und kulturellen Stellenwert
Das gilt sowohl für die „Muster im Rapport“ bei fortlaufender Meterware wie auch für die „abgepasste Ware“ nach einem vorgegebenen Maß, – Tischdecken und Servietten, die Gegenstand der Ausstellung sind. Der Wert dieser Tücher liegt nun nicht mehr im Material, sondern primär im künstlerischen Entwurf des Musters. Eine Besonderheit dieser Produkte bildet zudem die neuartige Verbindung von Künstlerentwurf und industrieller Fertigung. Dieses fortschrittliche Zusammenwirken von „Kunst und Maschine“ – wie die zeitgenössischen Beobachter gern formulierten – wurde in der Entstehungszeit der Werke vielfach als Problem empfunden. Die meisten der avantgardistischen Künstler sahen gerade darin aber eine stimulierende künstlerische Herausforderung und waren sich zudem der weitreichenden kommerziellen Möglichkeiten bewusst, die diese Ware bot.
Die Ausstellung behandelt das Aufkommen des speziellen Zusammenwirkens von Kunst und Industrie und das Auftreten von „Werkbundideen“ noch vor dessen Gründung 1907. Die Künstler und die publizistischen Wortführer dieser neuen Kunst schrieben ihr vielfach eine erzieherische Funktion bei der erstrebten generellen Geschmacksverbesserung des Publikums zu. Mit der Forderung, Gegenstände des täglichen Gebrauchs nach Künstlerentwürfen massenhaft herzustellen, hatten sie besonders die Zielgruppe der Frauen an der Schaltstelle ihres Wirkens, bei der Einrichtung des Hauses, im Auge. Mit dem qualitätvollen Angebot der Textilien sollten die Frauen zu Stilsicherheit und Kultur überhaupt erzogen werden.
Viele der gezeigten Objekte sind problemlos zu identifizieren, manche aber auch sehr schwer mit bestimmten Künstlernamen zu verbinden. Als Quelle für die hier vorgenommenen Zuschreibungen dienen zeitgenössische Zeitschriften mit Abbildungen und Berichten über Textilausstellungen und Wettbewerbe. Auch zwei erhaltene Archive in den Textilzentren Stuttgart-Laichingen und Bielefeld bieten die Grundlagen für zahlreiche Bestimmungen und Datierungen. Die erste dieser Firmen ist heute noch in Besitz umfangreicher Musterbücher mit Stoffproben als Exempel für den Typus der farbigen „Gartentischdecke“, die zweite – eine der bedeutendsten Leinendamastfirmen – bewahrt noch sämtliche Dekore in Form von Servietten, in Vertreterbüchern mit Stoffprobenabschnitten, in Preislisten und Korrespondenzen. Einige Entwurfszeichnungen der herausragenden Jugendstilkünstler Otto Eckmann, Joseph Maria Olbrich und Richard Riemerschmid ergänzen die Darstellung des Entstehungsprozesses der ausgestellten Textilien.
Katalog
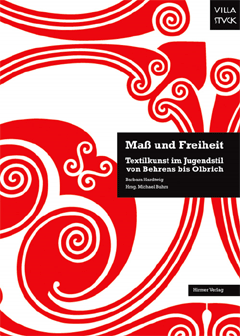
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog im Hirmer Verlag, herausgegeben von Michael Buhrs. Die Autorin des Katalogs und Kuratorin der Ausstellung, Dr. Barbara Hardtwig, stellt in einem Einführungsaufsatz die Entstehungsgeschichte dieser neuartigen Kunstgattung, ihre Etablierung in der öffentlichen Diskussion sowie auf dem Kunstmarkt und die verschiedenen künstlerischen Intentionen dar. Erläutert werden zudem Form und Herkunft aller Exponate.
220 Seiten, ca.125 Farbabbildungen

